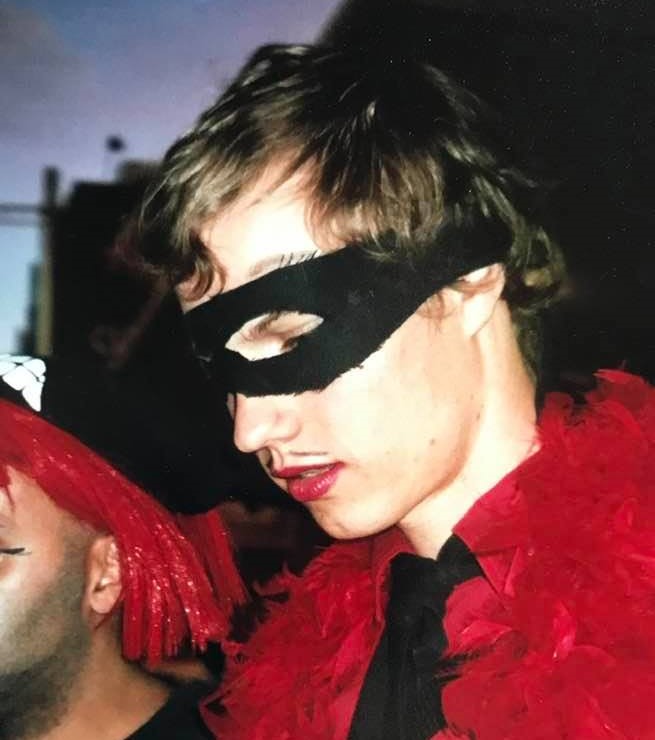Crowdfunding für Gustav Landauer Denkmal. Konstantin Wecker übernimmt Schirmherrschaft für das Denkmalprojekt in Berlin
Am 29. April 2025 hat die Gustav Landauer Initiative (GLI) zusammen mit Unterstützer:innen im Rahmen einer feierlichen Auftaktveranstaltung die Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung des künstlerischen Wettbewerbs für das Berliner Landauer-Denkmal eröffnet.(1) Konstantin Wecker hat mit Verve die Schirmherrschaft für das Denkmalprojekt übernommen. Auf einer Ecke direkt am Mariannenplatz vor der Nürtingen-Grundschule in Kreuzberg soll das Landauer-Denkmal entstehen. Jan Rolletschek – Kulturwissenschaftler, Landauer-Kenner und organisiert in der GLI – hat dies zum Anlass genommen, um auf den erinnerungspolitischen Ort des Anliegens zu reflektieren. Wir dokumentieren seinen Essay; eine gekürzte Fassung wurde bei der Auftaktveranstaltung am 29. April vorgetragen. (Red.)
In seinem Text zur jetzt beginnenden Kampagne mahnt Konstantin Wecker eindringlich, dass es den Faschisten niemals gelingen dürfe, die Erinnerung an Menschen wie Gustav Landauer auszulöschen, und er ruft dazu auf, sich „an die Ideen und Utopien der Getöteten [zu] erinnern“.(2) Diese Mahnung ist nicht trivial, ihre Dramatik nicht übertrieben. An Landauer und die anarchistische Bewegung seiner Zeit zu erinnern, würde sich erübrigen, wären ihre Ziele heute erreicht. Dem ist nicht so. Im Gegenteil ist diese Überlieferung heute so bedroht wie lange nicht mehr.(3)
Strittiges Gedenken
Die Diskussion um Praktiken des öffentlichen Gedenkens hat in den letzten Jahren erheblich an Fahrt aufgenommen. Denkmalstürze und Straßenumbenennungen gehören zu den Folgen. Begriffe wie „Gegen-Monument“ oder „Streitwert“ eines Denkmals bereichern die jüngere Diskussion. Zugleich stehen Erinnerungsorte emanzipatorischer Bewegungen unter Druck. Antifaschistische Denkmäler werden angegriffen, jüdische Erinnerungsorte geschändet, und im Mai 2024 hat die russische Armee das Nestor Machno-Denkmal in Guljapole gezielt mit einer Rakete zerstört. All dies zeigt: Das historische Gedächtnis unserer Gesellschaften ist umstritten.
Dabei wirken Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum wohl gerade deshalb besonders provokant, weil sich hier sichtbar ein Gemeinsames konstituiert. Sie verlassen die Sphäre des nur Privaten und unverbindlich Partikularen. Sie übersteigen auch den Bereich jeder Teilöffentlichkeit, wie sie eine fragmentierte Medienlandschaft in zunehmender Zahl erzeugt. Stattdessen geben sie einer Überzeugung öffentlich Ausdruck. Sie statuieren, für alle sichtbar, ein historisches Geschehen als eben dieses oder stellen öffentlich eine Identitätsbehauptung auf. Als Kristallisationspunkte der Auseinandersetzung um das Selbstverständnis und die Entwicklungsrichtung einer Gesellschaft sind sie in grundlegender Weise strittig.
Doch nicht nur der Erinnerungs- und Streitwert gemachter, sogenannter „gewollter“ Denkmäler, geradezu ihre Sichtbarkeit scheint davon abzuhängen, dass sie regelmäßig erneuert und, zu geeigneten Anlässen, aktiv hergestellt wird. „Es gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denkmäler“, hat Robert Musil in einem viel zitierten Essay über ihr eigentümliches, auf Gewöhnung basierendes Verschwinden bemerkt. Es ist daher nötig, sich auch der Erinnerungszeichen von Zeit zu Zeit zu erinnern. Die Wirksamkeit von Denkmälern ist selbst abhängig von einer Vielzahl sozialer Praktiken und Denkmaldiskussionen, in die sie eingewoben sind. Auch ihre Funktion und Bedeutung stehen darin auf dem Spiel.
Drei Arten von Denkmälern
Wir sind es gewohnt, Denkmäler dafür zu kritisieren, dass sie das historisch Gewordene affirmieren und zu verewigen streben. „Die meisten Denkmäler dienten und dienen der Apologie der Herrschenden“, hat Wolfgang Wippermann diesen Umstand lakonisch kommentiert. Oder sie erinnern an die dunkle Seite der Geschichte und halten vergangenes Grauen mahnend präsent — was paradoxerweise ebenso zur Rechtfertigung gegenwärtigen Unrechts dienen kann. Auch kann ein und dasselbe Denkmal seine Funktion durchaus ändern. Diese ist nicht gänzlich in Stein gemeißelt, sondern abhängig von veränderlichen Deutungshorizonten. „Dulce et decorum est pro patria mori [süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben]“, lesen wir auf einem der über 100.000 Kriegerdenkmäler auf dem Gebiet der Bundesrepublik. Dieses steht vor der Nürtingen-Grundschule, errichtet „zum ehrenden Andenken“ an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Schüler des damaligen Gymnasiums. — Übrigens hat Landauer direkt um die Ecke in der Redaktion des „Sozialist“ schon 1911 Maßnahmen zur Verhinderung dieses Krieges geplant, ein ganz und gar spektakuläres Unterfangen, das leider durch einen Spitzel verraten wurde. — Am Fuß des besagten Denkmals hat die Bezirksverordnetenversammlung von Kreuzberg 1986 eine Tafel anbringen lassen, welche die ideologische Vorbereitung auf den „sogenannten Heldentod“ durch die zitierte Formel kritisch kommentiert und fordert: „NIE WIEDER KRIEG!“ Die Einfassung problematischer Denkmäler durch den auf eine andere Deutung zielenden Kommentar war in den 1980er Jahren eine übliche Methode des Umgangs mit diesem Erbe. Ein „positives“ sollte so zu einem „negativen“ Denkmal werden, die Affirmation ersetzt werden durch Kritik und Mahnung.
Was in der aktuellen Diskussion jedoch fast gänzlich fehlt, sind Denkmäler einer dritten Kategorie: Solche Denkmäler nämlich, die unseren Blick nicht in der Vergangenheit fixieren, sondern das Werden einer anderen Zukunft vorbereiten, indem sie sich dem uneingelösten Versprechen eines Gewesenen zuwenden. Diese Denkmäler haben indes längst einen Platz in der erinnerungspolitischen Diskussion, der hier einmal skizziert werden soll. Wie passend ist es da, dass Landauer selbst uns diesen Platz zeigt.
Geschichte als Konstruktion
In seiner 1907 erschienenen Schrift „Die Revolution“ hat Landauer – an Ansichten Arthur Schopenhauers sich anschließend – darauf hingewiesen, dass die Geschichte keine „echte Wissenschaft“ sei, da sie nicht, wie diese, Einzelnes unter einen Begriff bringt, sondern ihr umgekehrt ein jeweiliger Gegenstand bei näherem Hinsehen in allerlei Einzelheiten zerfällt. Was die Geschichte jedoch schafft, sagt uns Landauer, sind „Mächte der Praxis“. Denn die „Hilfskonstruktionen“, zu denen sie immerhin genötigt ist, dienen nicht nur „der Verständigung, sondern vor allem [der] Schaffung neuer Tatsächlichkeiten, Gemeinschaften, Zweckgestalten, Organismen höherer Ordnung. […] Jeder Blick in Vergangenheit oder Gegenwart menschlicher Gruppierungen ist ein Tun und Bauen in die Zukunft hinein. Und ebenso ist die entgegengesetzte Richtung, die die seienden und lastenden Konstruktionen der Geschichte wieder […] auflöst, nicht bloß in theoretischer Hinsicht kritisch, auflösend und destruktiv: sie zerstört vielmehr in der Praxis.“ Die Vergangenheit bleibt unabgeschlossen und Gegenstand einer Konstruktion; auch sie ist „Zukunft“, die sich mit unserem Weiterschreiten verändert und anders gewesen sein wird. „Die Vergangenheit ist das, wofür wir sie nehmen, und wirkt dementsprechend sich aus“. Der Diskussionszusammenhang, in den Landauer sich mit diesen Erörterungen eingeschrieben hat, wurde vor ihm maßgeblich durch Friedrich Nietzsche geprägt.
Als Landauer während des Krieges auf seine historischen „Ausgrabungen“ zu sprechen kam, die er unter der Kriegszensur im „Sozialist“ dargeboten hatte und die — verständige Leser:innen vorausgesetzt — auch zu seiner Gegenwart sprechen würden, schrieb er dem befreundeten Anarchisten Hugo Warnstedt, er „bleibe dabei, daß die Großen aller Völker und Zeiten uns als lebendige Mitarbeiter dienen müssen, ganz besonders, solange die angeblich lebenden Zeitgenossen versagen. Mir leben die Toten, wie mir gar zu viele der Lebenden tot sind.“
Landauer knüpfte so an einen Gedanken an, den Nietzsche in seiner unzeitgemäßen Betrachtung „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“ folgendermaßen auf den Punkt gebracht hat: „Die Geschichte gehört vor Allem dem Thätigen […], der Vorbilder, Lehrer, Tröster braucht und sie unter seinen Genossen und in der Gegenwart nicht zu finden vermag. […] Dass die grossen Momente im Kampfe der Einzelnen eine Kette bilden, dass in ihnen ein Höhenzug der Menschheit durch Jahrtausende hin sich verbinde, dass für mich das Höchste eines solchen längst vergangenen Momentes noch lebendig, hell und gross sei — das ist der Grundgedanke im Glauben an die Humanität, der sich in der Forderung einer monumentalischen Historie ausspricht.“
Was ist nun diese monumentalische Historie, was hat Landauer aus ihr gemacht und was geht sie uns heute womöglich noch an?
Monumentalische Geschichte
Grundsätzlich hat Nietzsche in der zitierten überaus einflussreichen Schrift gegen den Historismus opponiert und ein gewisses Übermaß und Übergewicht der historischen Bildung über das Leben als eine Krankheit der Zeit und vor allem der Deutschen charakterisiert. Er sprach von einem „historischen Fieber“, das jeden tätigen Entschluss lähmt, alle Lebenskräfte verzehrt und zu einer vom Leben selbst abgewandten, das Leben bedrohenden, nur beschaulich genießerischen und distanziert ironischen Existenzweise führt. Das Leben werde geopfert, wenn man es ganz in den Dienst der Historie stellt. Für Nietzsche aber sollte es umgekehrt sein: „Nur soweit die Historie dem Leben dient, wollen wir ihr dienen“. So lautete sein Appell.
Dabei hat Nietzsche drei Arten der Historie unterschieden, eine Unterscheidung, an die Landauer sich anlehnen würde und die auch heute noch beobachtet werden kann, wo es um Geschichte im Allgemeinen und Denkmäler im Besonderen geht.
Die Historie, sagt uns Nietzsche, könne hauptsächlich „monumentalisch“, „antiquarisch“ oder „kritisch“ sein, was jeweils mit einem besonderen Nutzen und Nachteil, mit Vorzügen und Gefahren verbunden sei. Keine dieser Weisen, sich dem Vergangenen zuzuwenden, dürfe man vermissen lassen; nur komme es auf ihr Gleichgewicht an und auf ihre gegenseitige Korrektur, also darauf zu wissen, wann es angezeigt ist, sich der einen oder anderen Einstellung zu befleißigen.
Die „monumentalische“ Geschichte, heißt es, baut neue Konstruktionen, welche die „antiquarische“ bewahrt und die „kritische“ wiederum auflöst und zerstört. Sie zerbricht von Zeit zu Zeit die Konstruktionen der Vergangenheit, indem sie diese einer peinlichen Befragung unterzieht, um Platz für neue Hilfskonstruktionen zu schaffen. Dies ist es, was Landauer eine „Revolution der Geschichtsbetrachtung“ nennen wird.
Die oben beschriebene Gefahr einer bloß beschaulichen Existenz haftet vor allem der „antiquarischen“ Historie an, die unterschiedslos alles notiert. Sie weiß das Bedeutende nicht vom Unbedeutenden zu unterscheiden. Ihr fehlt der Abstand und damit jedes vergleichende Maß. Doch auch die „kritische“ Historie kann das Leben untergraben, wenn sie nicht richtet, um neu zu erbauen, sondern überhaupt die „Atmosphäre“, welche alles Lebendige schützend umhüllt, pietätlos zerstört. Umgekehrt steht die „monumentalische“ Historie am nächsten der Gefahr, die Vergangenheit der „freien Erdichtung“ anzunähern, mutwillig vieles zu übersehen, was ihr nicht passt, und das Wenige, was zur Nachahmung empfohlen wird, zu idealisieren.
Die monumentalische Geschichte steht jedoch auch jenem Element am nächsten, welches Nietzsche „das Unhistorische“ nannte, und welches eben jene umhüllende „Atmosphäre“ sei, in der allein das Neue entsteht.
Das Unhistorische
Landauer wusste, dass sich seine Beschreibung des sogenannten Mittelalters als Zeit der Kulturhöhe und freiwilligen Einung den Gefahren der monumentalischen Historie aussetzt. Er antizipierte den Einwand, dass es so einfach nicht sei und entgegnete: „Wissen kommt nicht durch bloßes Sehen zustande; es bedarf auch des Übersehens, wie das Leben das Vergessen ebenso braucht wie das Behalten.“ Ohne Vergessen keine historische Konstruktion.
Dies war ganz das Argument Nietzsches, der eine Begrenzung des historischen Sinns für lebensnotwendig befand: „Zu allem Handeln gehört Vergessen: wie zum Leben alles Organischen nicht nur Licht, sondern auch Dunkel gehört.“ Das Leben selbst stehe dabei auf dem Spiel. Ja, es sei „ganz und gar unmöglich, ohne Vergessen überhaupt zu leben“ und glücklich zu sein ohne die Fähigkeit, sich „auf der Schwelle des Augenblicks“ niederzulassen und unhistorisch zu empfinden.
Gilles Deleuze würde später seine zunehmende Sensibilität für jene Unterscheidung des Werdens von der Geschichte bezeugen und mit Nietzsche von einer „Dunstschicht des Unhistorischen“ sprechen, ohne die „nichts Wichtiges“ zustande kommt. Nietzsche hatte noch deutlichere Worte. Er sprach von einem umhüllenden „Wahn“ – eine Vokabel, mit der auch Landauer vorübergehend experimentieren würde – oder einer „Illusions-Stimmung, in der Alles, was leben will, allein leben kann“. Es sei diese Beschränkung des Horizonts, die es allererst erlaube zu handeln; dies vor allem!
Die Hinwendung auf Gewesenes sollte zuweilen zugleich ein Handeln sein, in dem sich die „plastische Kraft“ bewährt, seine Kenntnis der Vergangenheit in den Dienst von Zukunft und Gegenwart zu stellen und seine Lebenskräfte aus ihr zu beziehen. Entgegen einer nur passiv beschaulichen Inventarisierung des historischen Geschehens handelte es sich für Nietzsche um den „Versuch, sich gleichsam aposteriori eine Vergangenheit zu geben, aus der man stammen möchte“. Die hierzu nötige Kraft aber werde durch ein Übermaß an Historie unterminiert.
Bedrohte Überlieferung
Ein anderer Leser Nietzsches – wie auch Landauers – wollte jenes rein vitalistische und beinahe willkürliche Element, das der Geschichtskonstruktion im antihistoristischen Diskurs anzuhaften schien, eliminieren, ohne deshalb auf eine naiv realistische Position zurückzufallen. Sicher, die Vergangenheit war eine rückwirkende Konstruktion, aber ihr Bild sollte sich ebenso unwillkürlich einstellen, wie es das Bild einer subjektiven Erfahrung war; nichts sollte vergessen und das Eigenrecht des objektiv Erkennbaren in der Geschichte gewahrt werden. „Das wahre Bild der Vergangenheit“ – subjektiv und objektiv zugleich – blitzt auf „im Augenblick einer Gefahr“ und droht, „mit jeder Gegenwart zu verschwinden […], die sich nicht als in ihm gemeint erkannte.“
Auf der Flucht vor den Nazis schrieb Walter Benjamin 1940 in seinen Thesen „Über den Begriff der Geschichte“, der Faschismus werde sich auch der Vergangenheit zu bemächtigen suchen, und „auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein“. Diese Mahnung bezog sich auf das Europa des Jahres 1940, jedoch nicht nur. Benjamin wollte sie auch in einem weiteren Sinn verstanden wissen: „In jeder Epoche muß versucht werden, die Überlieferung von neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen.“ Die Überlieferung, von der er sprach, ist die Tradition der Unterdrückten, der immer wieder unterbrochene Gang der Revolution, das unter der Geschichte der Sieger begrabene Erbe. „Streift denn nicht uns selber ein Hauch der Luft, die um die Früheren gewesen ist? ist nicht in Stimmen, denen wir unser Ohr schenken, ein Echo von nun verstummten?“ So lauten die Fragen in diesem testamentarischen Text. Es bestehe, schrieb Benjamin, „eine geheime Verabredung zwischen den gewesenen Geschlechtern und unserem.“ Wir seien auf der Erde erwartet worden, und die Früheren hätten einen „Anspruch“ an unsere Kraft, der billig nicht abzufertigen sei. Die Philosophin Eva von Redecker hat diese Sätze zitiert, als sie in ihrer die Denkmalinitiative unterstützenden Stellungnahme schrieb: „Das Landauer-Denkmal wäre eine angemessene Geste, um sich dieses Anspruchs bewusst zu zeigen.“
Rekontextualisieren wir diese Sätze, so zeigt sich ihr spezifischer Sinn. Sie verweisen über den Text Benjamins hinaus auf die „monumentalische […] Historie“ Nietzsches und darauf, was Landauer „Vergegenwärtigung“ nannte, denn: „In der Tat wird in aller Geschichte das Vergangene vergegenwärtigt, zur Gegenwart gemacht“; und in diesem Akt sind Verwirklichung und Erkenntnis, „Erkenntnis und Schöpferkraft vereinigt“. Sollten diese Hinweise auf eine Form der Erinnerung, deren Aufgabe es ist, „im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen“, um nochmals einen Ausdruck Benjamins zu gebrauchen, nicht ebenso viele Hinweise auf jene dritte Art von Denkmälern sein, die dem Werden einer anderen Zukunft dienlich sind?
Monument als Mittler
Landauers Geschichtskonstruktion zielte auf eine schöpferische Wiederholung. „Ich dichte, lieber Freund; ich dichte an meinem Volk“, hatte er dem Philosophen Constantin Brunner einmal bekannt, an einem Volk, das über die Nationen geht.(4) Dieser prophetischen Geste hat sich auch Gilles Deleuze immer wieder bedient und dabei auf jene „Dunstschicht des Unhistorischen“ verwiesen, in der ein Werden sich von den überkommenen Konstruktionen löst. „Die Revolution“, heißt es in seinem letzten, mit Felix Guattari geschriebenen Buch, „ist die absolute Deterritorialisierung an jenem Punkt, an dem diese nach der neuen Erde, dem neuen Volk ruft.“ Die traditionell messianistische Wendung wird hier völlig immanentisiert.
Über die Kunst lesen wir ähnlich, sie werbe „um ein künftiges Volk“ und schaffe, wie es wohl auch in Anspielung auf Nietzsche heißt, „ein zusammengesetztes Monument aus Perzepten, Affekten und Empfindungsblöcken […] – mit Blick, so ist zu hoffen, auf jenes Volk, das noch fehlt“. „Ein Monument gedenkt nicht, feiert nicht etwas, das sich ereignet hat, sondern vertraut dem Ohr der Zukunft die fortbestehenden Empfindungen an, die das Ereignis verkörpern“; es verlängert nicht das historisch Gewordene in die Zukunft, sondern ist Mittler dessen, was noch werden soll.
Vielleicht lassen sich aus den hier angedeuteten Kontexten Elemente eines Begriffs der Erinnerung gewinnen, die uns dabei behilflich sein können, über das Berliner Landauer-Denkmal nachzudenken. Denn offenbar kann es mit diesem Denkmal nicht, oder nicht in erster Linie, um die Würdigung eines Vorkämpfers all dessen gehen, was sich heute glücklich erfüllt hätte. Nicht zuletzt wäre dies ein gänzlich affirmativer, das kritische Potenzial des Vergangenen einhegender Ansatz des Gedenkens. Er liefe auf die Indienstnahme Landauers für das Bestehende hinaus, auf jenen Konformismus, der die Überlieferung bedroht. Wir brauchen Landauer jedoch nicht als einen Vorkämpfer gerade dieser Gesellschaft. Vielmehr geht es um die Erinnerung dessen, was als Unerfülltes in ihr insistiert. Wir brauchen Landauer als einen schürenden Geist. Wir wollen ihn nicht – um nochmals Robert Musil zu zitieren – „mit einem Gedenkstein um den Hals […] ins Meer des Vergessens“ stürzen und auch keinen solchen Stein auf sein Grab wälzen. Wir wollen – um also in der Metapher zu bleiben – nicht seine würdigende Beerdigung, sondern eher noch seine lebendige Auferstehung.
Wir brauchen Landauer deshalb auch nicht in erster Linie als ein frühes Opfer des aufkommenden Faschismus. Erinnern wir uns daran, dass er dies allerdings war. Sagen wir auch, was er erlitten hat und was ihm zugefügt wurde, aber bestreiten wir den Faschisten vor allem ihren Sieg. Denken wir mithin an die Mahnung Konstantin Weckers und erinnern wir uns daran, wer Gustav Landauer war, was er gewollt und getan hat, und was auch heute noch unabgegolten ist. Die spezifische Form des Weiterwirkens vergangener Utopien ist ihre „Erinnerung“ im 1907 von Landauer erörterten Sinn. Töten, Sterben- und Leidenmachen, das ist das Werk des Faschismus. Ein Legionär kann einen Mathematiker, ein brutalisierter Soldat einen Menschen wie Gustav Landauer erschlagen. Das ist die Naturgewalt der Dummheit und des traurigen Affekts. Was hat Landauer damit zu tun? Sein Werk ist ein anderes. Und hat dieses Werk etwa kein Leben in sich? Kann uns Landauer nicht auch heute noch ein lebendig Wirkender und Weiterwirkender sein? Ich meine ja. Bliebe also die Frage, ob wir zu dieser Verabredung erscheinen.(5)
Jan Rolletschek
Anmerkungen:
- Es ist möglich, die Kampagne finanziell zu unterstützen: durch Beiträge auf der Projektseite bei Startnext https://www.startnext.com/landauer-denkma und direkt an den Förderverein demokratische Erinnerungspolitik e.V. https://erinnerungspolitik.de/. Auf der Webseite der Gustav Landauer Initiative finden sich weitere Informationen: https://gustav-landauer.org.
- Konstantin Weckers Text zum Auftakt der Kampagne ist in der Wochenzeitung „der Freitag“ erschienen und als Video-Botschaft auf seinem YouTube-Kanal. Vgl. Konstantin Wecker: Die Menschheit soll nicht verrecken. In: der Freitag. Die Wochenzeitung, Nr. 17 vom 24. April 2025, S. 24. Online: https://www.freitag.de/autoren/konstantin-wecker/konstantin-wecker-gustav-landauer-soll-ein-denkmal-bekommen und https://wecker.de/ein-denkmal-fuer-gustav-landauer-wir-brauchen-eure-unterstuetzung.
- Anstatt diesen Essay mit Anmerkungen zu überfrachten, nenne ich im Anschluss nur die hauptsächlich verwendete Literatur.
- Daran, dass der Begriff des ‚Volkes‘, trotz seiner langen demokratischen Tradition, für links-emanzipatorische Kontexte in Deutschland nahezu unmöglich ist, zeigt sich, dass die Sprache des Dritten Reiches auch heute noch nicht aufgehört hat zu siegen. „Wie viele Begriffe und Gefühle hat sie nicht geschändet und vergiftet!“ (Victor Klemperer, LTI). Vgl. auch: „Es gibt in Deutschland kaum demokratische Denkmäler“. Warum Berlin des Anarchisten Gustav Landauer gedenken sollte (Interview). In: Der Rabe Ralf. Die Berliner Umweltzeitung, 35. Jg., Nr. 242 (Oktober/November 2024), S. 5. Online: https://www.grueneliga-berlin.de/publikationen/der-rabe-ralf/aktuelle-ausgabe/landauer/.
- Bei der erneuten Lektüre eines zehn Jahre alten Artikels, also fast vom Beginn der Berliner Denkmalinitiative, ist mir aufgefallen, wie sehr der vorliegende Essay an jenen älteren Text anschließt. Vgl.: Gustav Landauer Denkmalinitiative [jr]: Ein Gustav Landauer-Denkmal für Berlin!? In: Gǎi Dào. Zeitschrift der Anarchistischen Föderation, Nr. 54 (Juni 2015), S. 26-28. Online: https://fda-ifa.org/gai-dao-nr-54-juni-2015.
Literatur
- Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, Bd. I.2, S. 691-704.
- Gilles Deleuze: Unterhandlungen 1972-1990. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993.
- Gilles Deleuze / Félix Guattari: Was ist Philosophie? Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000.
- Gustav Landauer: Die Revolution. Frankfurt am Main: Rütten & Loening 1907.
- Gustav Landauer: Sein Lebensgang in Briefen. Zwei Bände. Herausgegeben von Martin Buber und Ina Britschgi-Schimmer. Frankfurt am Main: Rütten & Loening 1929.
- Robert Musil: Nachlass zu Lebzeiten. Zürich: Humanitas 1936.
- Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben. In: Kritische Studienausgabe, Bd. 1. Herausgegeben von Giogrio Colli und Mazzino Montinari. 2. Aufl. München 1999, S. 157-334.
- Konstantin Wecker: Die Menschheit soll nicht verrecken. In: der Freitag. Die Wochenzeitung, Nr. 17 vom 24. April 2025, S. 24. Online: https://www.freitag.de/autoren/konstantin-wecker/konstantin-wecker-gustav-landauer-soll-ein-denkmal-bekommen.
- Wolfgang Wippermann: Denken statt denkmalen. Gegen den Denkmalwahn der Deutschen. Berlin: Rotbuch 2010.