„Dran, dran, dieweil das Feuer heiß ist! Laßt Euer Schwert nicht kalt werden […] Es ist unmöglich, dass ihr die Menschenfurcht verliert, solange die Tyrannen am Leben sind. Man kann Euch nichts von Gott sagen, solange sie über Euch regieren! Dran, dran, solange Ihr Tag habt! Gott geht Euch voran, folgt, folgt!“
Am 15. Mai 1525 unterlag ein großes Bauernheer den Fürsten in der Schlacht bei Frankenhausen/Thüringen. Damit gingen die Erhebungen der Bauernkriege in Deutschland zuende. Deren ideeller Kopf Thomas Müntzer, von dem die obigen Worte stammen, wurde gefaßt und am 27. Mai 1525 bei Mühlhausen hingerichtet.
Vor 500 Jahren gingen Müntzer und die Bauern als sozialrevolutionäre Vorkämpfer in die Geschichte ein. Doch Würdigung erfuhren sie erst in den 1840er Jahren durch das Geschichtswerk von Wilhelm Zimmermann mit dem Titel „Der große deutsche Bauernkrieg“. Spätestens zur 450 jährigen Wiederkehr 1975 etablierte sich eine Bauernkriegsforschung in beiden deutschen Staaten, bzw. eine spezielle Forschung zu Thomas Müntzer in der DDR.
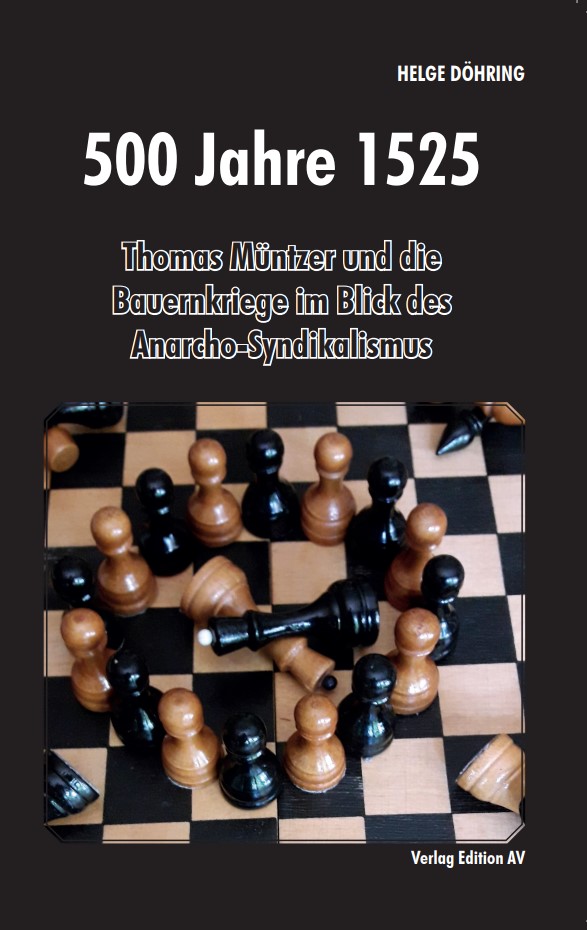
Ein paar Namen und Werke zum Einstieg möchte ich empfehlen, dazu zählen Peter Blickle, Hans Jürgen Goertz und Günter Vogler. Auf künstlerischer Ebene lohnt sich der Einstieg ins Thema mit Yaak Karsunke „Bauernoper/Ruhrkampf Revue“ (1976), Käthe Kollwitz: „Bauernkrieg“ (1908), Vicki Spindler: „Ottilie Müntzer. Der Regenbogen endet nicht“ (2017) sowie „Am jüngsten Tag“ (2025), Werner Tübke: „Bauernkriegspanorama“ (1987) und Friedrich Wolf: „Der arme Konrad“ (1923).
Keine Frage, die Bauernkriegsthematik wird in der Öffentlichkeit auch nach 500 Jahren breit rezipiert, beispielsweise in Bauernkriegsmuseen und mit staatlichen Landesausstellungen in Baden-Württemberg und in Thüringen. Was aber haben die Kämpfe der Bauern des ausgehenden Mittelalters mit dem modernen Anarcho-Syndikalismus, der sozialrevolutionären Gewerkschaftsbewegung der Industriearbeiterschaft des 20. Jahrhunderts zu tun? Angesichts bürgerlicher und marxistischer Dominanz in der Geschichtsschreibung und Präsentation, blieben solche Aspekte und Vergleiche weitgehend im Dunkeln.
Immerhin betonte der international angesehene anarcho-syndikalistische Theoretiker Rudolf Rocker (1873-1958) in seinem Memoiren, er habe sich als Jugendlicher über die Lektüre Wilhelm Zimmermanns für revolutionäre Anliegen begeistern lassen und politisiert. Später sollte er den Revolutionsführer Thomas Müntzer in mehreren Presseartikeln würdigen, ihn als „Vorläufer des Sozialismus“ und als „Monumentalfigur der deutschen Geschichte“ ehren.
Gemeinsamkeiten in den programmatischen Vorstellungen von 1525 und 1925
Auf ökonomischem Gebiet stand der Gedanke der Gleichheit im Vordergrund: „Omnia sunt communia“. Das Land und die Produktionsmittel sollten allen Menschen gehören, genauso, wie die Erträge aus der Allmende, der Forstwirtschaft, Fischerei, Jagd und Feldernte. Steuerabgaben waren hinfällig mit Ausnahme des „Zehnt“, von dem die vom Volk legitimierten Priester bezahlt und die Armen unterstützt werden sollten.
In politischen Angelegenheiten sollten alle gleichberechtigt entscheiden können, politische Macht dezentralisiert und auf freie Gemeinden verteilt werden. Während in den reformatorischen Hauptforderungen den „12 Artikeln“ das Kaisertum unangetastet blieb, richtete sich Thomas Müntzer gegen jede Staatsform, bzw. politische Zentralisation. Jede Form der Leibeigenschaft, Zwangs- und Militärdienste und generell die Herrschaft des Menschen über den Menschen sollten aufgehoben werden zugunsten maximaler individueller Freiheiten. Die Priester als Träger medialer Macht sollten vom Volk gewählt werden. Thomas Müntzer ging soweit, dass überhaupt alle das Recht zur Predigt haben sollten: „die Leyen mussen vnser Prelaten vnd Pfarrer werden.“
In kultureller Hinsicht äußerte sich diese sozialrevolutionäre Bewegung antiklerikal. Keine Kirchen sollten sich in die persönlichen Belange zwischen den Menschen und in das Erziehungswesen einmischen. Der Weg zum Inneren, zum Selbst, nach damaliger Definition zu „Gott“, sei ein individueller Emanzipationsprozess, in den sich keine Zentralgewalt einmischen sollte. Wer bevormunde, handele unchristlich und gottlos. Das betraf die alte römische Kirche genauso, wie den „Protestantismus“ Luthers, der sich anschickte, die Bevölkerung einer neuen Herrschaft zu unterwerfen. Müntzer sprach sich für Taufe im Erwachsenenalter aus als bewußten Akt der Zuwendung zu „Gott“, ähnlich wie später die sozialrevolutionären „Wiedertäufer“. Dass alle Menschen dazu befähigt werden sollten zu predigen, zeugt vom kollektiven Wert emanzipierter Menschen für eine emanzipierte und damit freie, sich selbst versorgende und verwaltende Gesellschaft. Verantwortungsbewußtsein mit „gegenseitiger Hilfe“, ein hoher Bildungsgrad und sozial orientierte Handlungsweisen bilden ihr kulturelles Fundament.
In diesen drei Aspekten gesellschaftlichen Lebens greifen basisdemokratische Prinzipien, wie sie in ähnlicher Weise auch für den Anarcho-Syndikalismus charakteristisch sind. Ohne den Gottesbegriff war 1525 keine soziale Bewegung denkbar. Es besteht inhaltlich jedoch keine große Distanz, wenn dafür Synonyme wie Natur oder Psyche eingesetzt werden. Denn diese stecken, wie für die Christen „Gott“, schließlich „in uns allen“. Die Werte der Mitmenschlichkeit, der ökonomische Gleichheitsgedanke und die Freiheit der Individuen einschließlich gleichberechtigter politischer Partizipationsmöglichkeiten können mit oder ohne „Gott“ ähnlich ausfallen. Bei manchen Christen mag „Gott“ genauso wenig über dem Menschen stehen bzw. ein „höheres Wesen“ sein, wie bei den atheistischen Anarcho-Syndikalisten, bei denen es keinen „Gott“ gibt.
Weitere klassische Elemente zwischen dem 16. und dem 20. Jahrhundert
Spannend sind epocheübergreifend auch die politischen Parallelen verschiedener Lager. Was für die sozialrevolutionären Christen um Thomas Müntzer als reaktionäre protestantische Strömung galt, personifiziert im antirevolutionären Martin Luther, war für die Anarcho-Syndikalisten 400 Jahre später die Sozialdemokratie, präsentiert durch Friedrich Ebert, die mit Staat, Kapital und Militär paktierte. Führte vor 500 Jahren der Truchseß von Waldburg die militärische Konterrevolution an, so fand sich dafür vor 100 Jahren der sozialdemokratische „Bluthund“ Gustav Noske bereit. Auch die Kriegsführung verlief ähnlich: Die revolutionären Heere zeigten sich technisch weit unterlegen und wurden sukzessive durch Hinhaltetaktiken mittels Waffenstillständen und überraschendes Losschlagen der konterrevolutionären Truppen besiegt. Diese sammelten ihre Kräfte und schlugen stets geeint zu, während die revolutionären „Haufen“ nacheinander unterlagen, weil ihnen keine annähernd gute militärstrategische Koordinierung gelang. Sinnbildlich dafür stehen sowohl der „Weingartner Vertrag“ vor 500 Jahren als auch das „Bielefelder Abkommen“ vor knapp über 100 Jahren. In beiden Jahrhunderten wurde übrigens trotz Versprechungen der Fürsten und Militärs keine Gnade gewährt. Der Tod kam durch gleiche Mörderhand mit bestialischer Wucht über Gustav Landauer, wie über Thomas Müntzer.
Neben dem Mut und der strategischen Unbeirrbarkeit Thomas Müntzers betonte Rudolf Rocker auch dessen Einsicht: „dass er jeder lokalen Bewegung abhold war und klar begriff, dass die revolutionäre Bewegung nur dann Erfolg haben könne, wenn sie sich über ganz Deutschland ausdehnte.“ Jahrhunderte später entstand die anarcho-syndikalistische „Internationale“. Als deren Gewerkschaftssektion „Freie Arbeiter-Union Deutschlands“ (FAUD) 1925 ihren offiziell Müntzer gewidmeten Reichskongress beging, hielt Rocker vor tosendem Beifall eine feurige Rede und endete:
„So glaube ich den Kongress nicht besser beschließen zu können, als dass ich in letzter Stunde den Riesenschatten Thomas Müntzers in unserer Mitte heraufbeschwöre.“

Links:
Die Dramaturgin und Schauspielerin Vicki Spindler zu Thomas und Ottilie Müntzer:
Landesausstellungen zu den Bauernkriegen:
Das Buch zum Thema Bauernkriege und Anarcho-Syndikalismus:
500 Jahre 1525. Thomas Müntzer und die Bauernkrieg im Blick des Anarcho-Syndikalismus

