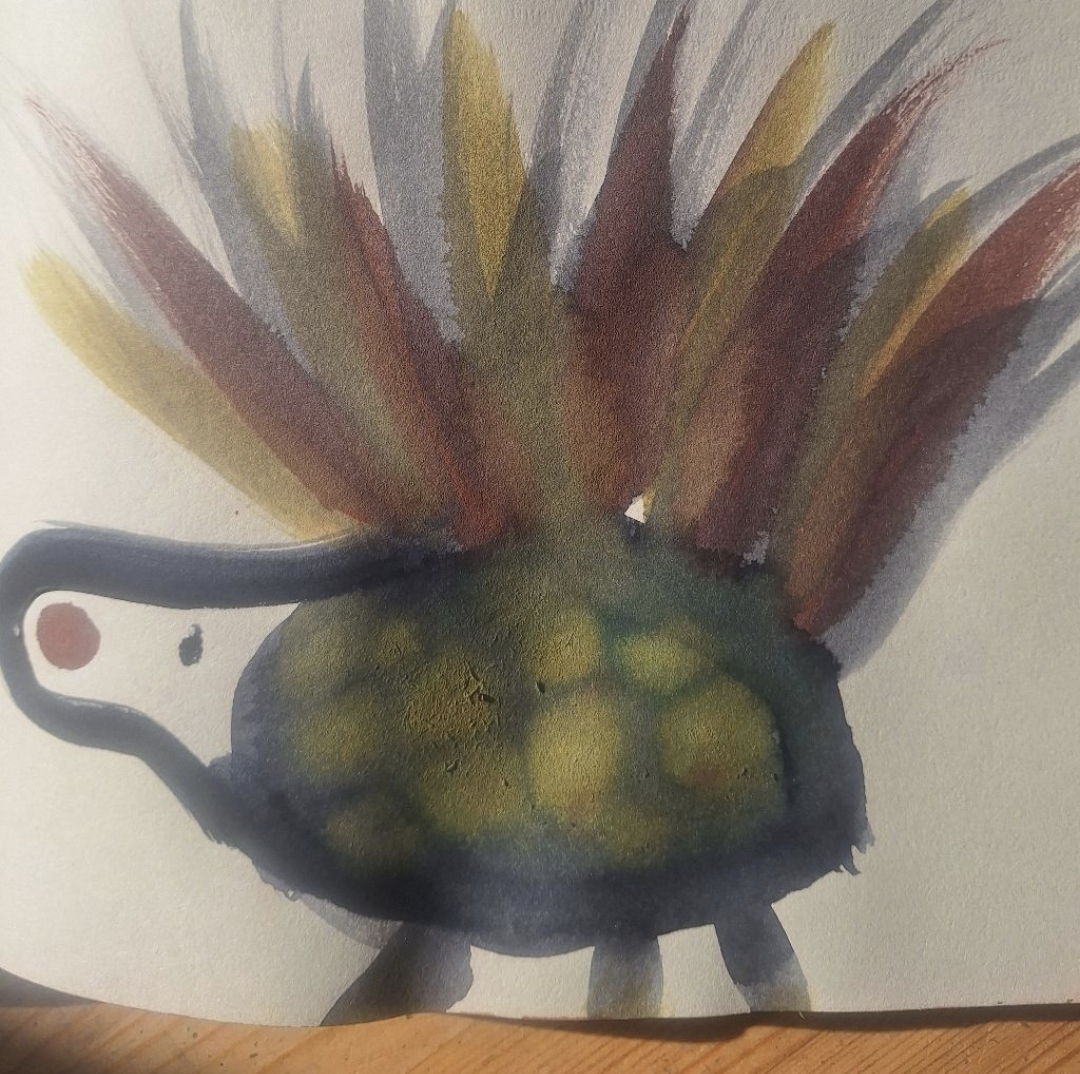Die Motivation zu nachfolgendem Text entstand aus einem Klärungsbedürfnis. Rund zwanzig Jahre war ich in einer trotzkistischen Kaderorganisation in Österreich aktiv, bevor ich mich vom Haupteinwand des Anarchismus gegenüber der Machtergreifung einer revolutionären Partei im Zuge einer sozialen Revolution überzeugen ließ: Dass nämlich die Befreiung der Arbeiter:innenklasse ihr eigenes Werk sein muss und ab Tag 1 der sozialen Revolution in ungebremster Eigeninitiative durch Betriebskollektive, Kommunen, Räten etc. begonnen werden muss. Volin hatte recht, als er schrieb: „Staatsozialistische Macht, falls sie siegt, und wahrer sozialrevolutionärer Prozess sind wesensmäßig auf Kampf gegeneinander eingestellt, auf expliziten, unversöhnlichen Gegensatz.“ (Anarchismus - Theorie, Kritik, Utopie, Verlag Graswurzelrevolution S. 213) Volines „Unbekannte Revolution“ und Maurice Brintons „Die Bolschewiki und die Arbeiter:innenkontrolle“ waren hierfür echte Augenöffner für mich. Somit kam ich dazu, mich nunmehr als Sozialisten in der revolutionären Arbeiter:innen-Tradition, die mit dem antiautoritären Flügel der 1. Internationale begann, zu definieren, d.h. als Anarchisten.
Als ich mich daraufhin im deutschsprachigen anarchistischen Spektrum umzusehen begann, stieß ich auf zwei Phänomene:
-
Erstens: dezidiert politische Organisationen sind im deutschsprachigen Anarchismus im Vergleich zur marxistischen Reichshälfte so gut wie inexistent. Selbst viele Gruppen, die auf anarchismus.de angeführt sind, hatten ihre letzte Aktivität, soweit diese aus dem Web ersichtlich ist, vor einigen Jahren oder die Website existiert gar nicht mehr. Im trotzkistischen bzw. marxistischen Spektrum kann man/frau sich dagegen sicher sein, dass auf einer größeren Demonstration mehrere Gruppen, die schon seit 20 – 30 Jahren existieren, mit eigenen Zeitungen erscheinen usw. Und dies macht meiner Meinung nach eine der Schwächen des organisierten Anarchismus aus. Denn seien wir ehrlich: Oftmals ist es für radikale Jugendliche eher zufällig, wo sie landen, wenn nur eine Gruppe ehrlich überzeugter Revolutionär:innen da ist, die ihren Antikapitalismus stringent in einer umfassenden Theorie darstellen kann (worin eine der Stärken des Trotzkismus liegt). Solche Gruppen gibt es z.B. in Österreich auf anarchistischer Seite – und das ist wirklich keine Übertreibung - schlicht gar nicht. Wie hätte ich überhaupt in Österreich politischer (kultureller, individueller, autonomer usw. natürlich schon) Anarchist werden sollen, wenn ich nicht selbst eine Gruppe aufbauen wollte?
-
Zweitens: es existiert über die Fakten, die ich im ersten Punkt erwähnt habe, im deutschsprachigen Anarchismus durchaus Problembewusstsein. Die klassenkämpferischen, plattformistischen oder especifistischen Strömungen, als deren Teil sich ja auch anarchismus.de sieht, sollen ja, wie ich es verstehe, genau die angesprochenen Mängel des politischen Anarchismus beheben helfen.
Nun kann ich aber nicht umhin, hier ein Grundproblem dieser Ansätze auszumachen: in dem starken Bemühen, sich ja keiner vermeintlichen Berührung mit Lenin schuldig zu machen, kommt es zu schwammigen, widersprüchlichen Aussagen. Wenn z.B. der Blogger Anark in einem hier auf dieser Website publizierten Text („der Staat ist konterrevolutionär“) einerseits an Lenin kritisiert, dass er das revolutionäre Bewusstsein von außen, von einer Gruppe Intellektueller, in die Arbeiter:innenbewegung tragen wollte, andererseits in einem seiner Youtube-Videos genau konträr dazu sagt, dass der Anarchosyndikalismus stets einer Begleitung durch revolutionäre Propagandaorganisationen bedarf, um nicht reformistisch zu werden, dann ist letzteres ja wohl nichts anderes als Leninismus?
Nun ist aber die Lösung des Problems gar nicht so schwierig. Das Problem liegt meines Erachtens nämlich mehr darin, dass eine Heidenangst davor besteht, des Leninismus bezichtigt zu werden, dass das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, d.h. es besteht kein Mut dazu, sich zu den historischen Traditionen der revolutionären Arbeiter:innenbewegung zu bekennen. Lenin selbst war ein Teil davon und praktizierte darin mit Methoden, die allgemein anerkannt waren: dass der intellektuell Teil der Arbeiter:innenklasse die Aufgabe hat, den Emanzipationsprozess der Arbeiter:innen mit möglichst klaren Ideen voranzubringen zu helfen.
Der überwiegende Teil aller revolutionären Anarchist:innen arbeiteten mit denselben Methoden wie Lenin: sie gruppierten sich um die Herausgabe einer Zeitung und versuchten, ihre Ideen in der Arbeiter:innenklasse zu verankern. Dass Lenin einige Aspekte dieser Methode herausstrich, gehört nicht zum Teil seiner historischen Fehler. Dass er z.B. die Herausgabe einer regelmäßig erscheinenden Zeitung als kollektiven Organisator der revolutionären Organisation sah, gehört meiner Meinung nach zutiefst zum A und O des Aufbaus einer spezifischen revolutionären Organisation. Haben nicht Leute wie Rudolf Rocker, Malatesta, Mühsam etc. genau dasselbe gemacht? Ja, weil dies damals Revolutionär:innen jeglicher Strömung gleichermaßen wichtig erschien. Wir sollten derlei nicht als Leninismus bezeichnen, damit stehen wir uns nur selbst im Weg. Lenin verlieh diesen Gedanken nur mehrmals explizite Aufmerksamkeit, das ist alles. Wo aber gibt es im deutschsprachigen Raum eine anarchistische Gruppe, die sich rund um die Herausgabe einer Zeitung gruppiert? Liegt darin vielleicht der Grund verborgen, warum alle Projekte zu schnell zusammenbrechen, weil revolutionäre Disziplin nicht abstrakt gefordert werden kann, sondern mit der Herausgabe einer Zeitung eine regelmäßige konkrete Aktualisierung erfährt? Ist die alltägliche Anpassung der revolutionären Theorie an die Erfordernisse der Gegenwart nicht genau die Aufgabe, die intellektuelle Arbeiter:innen zu erfüllen haben, wozu ich auch alle Personen rechne, die sich rund um diese Website gruppieren?
Mit der Angst vor dem Leninsmus ist eng verbunden die Furcht, durch eine revolutionäre Kaderorganisation in einen Elitarismus abzudriften, der die arbeitenden Menschen bevormundet und versucht, in ihrem Namen die soziale Revolution anzuführen. Da empfiehlt es sich, ein größeres Vertrauen in die Inhalte zu vertreten, die mit der eigenen Organisation vertreten werden. Ja, Lenin, betrieb neben dem Aufbau einer revolutionären Kaderorganisation (was nicht zu verurteilen ist) auch die Vorwärtsentwicklung einer Theorie, die die Ersetzung der Eigeninitative der Massen durch die Initiative einer Partei vorsah – das ist das Abzulehnende am Leninismus. Der organisierte Anarchismus sollte mehr darauf vertrauen, dass seine zentralen politischen Ideen auch seine Praxis bestimmen werden. Ein sehr faszinierendes Beispiel lieferte Volin („die unbekannte Revolution“), als er mitten in den Kämpfen der Machnowitschina als Intellektueller einer anarchistischen Organisation dem revolutionären Kongress der befreiten Gebiete als Vorsitzender diente. Weil er Anarchist war, konnte sich die Eigeninitiative der Teilnehmer:innen auf dem Kongress ungebremst ihren Weg bahnen. Wäre er dort nicht gesessen, wer weiß, unter welche parteiliche Bevormundung dieser Kongress wieder gefallen wäre? Geh ich fehl in der Annahme, dass durch Volin, als intellektuellen Anarchisten, der aufrichtig seiner Klasse diente, auf diesem Kongress genau das eintrat, was sich wohl der Especifismo unter der sozialen Einfügung vorstellt?
Aber Volin konnte sich gerade deswegen dieser Aufgabe stellen, weil er in der ganzen Zeit seines politischen Wirkens in Russland es nicht ablehnte, sich als revolutionärer Theoretiker an die Arbeiter:innenklasse zu wenden. Und dies tat Volin, obwohl er dann später sogar offen gegen den Plattformismus Stellung bezog. Das kann nur heißen, dass eine Praxis, die damals sogar von einem Gegner des Plattformismus gelebt wurde (Volin sprach sich gegen Machnos Projekt in Paris aus), auch für politische Anarchist:innen so basal sein müsste, dass es nur verwundert, warum sich der deutsprachige Anarchismus so schwer damit tut. Es geht einfach darum, dass man/frau sich als revolutionäre(r) Theoretiker:in und Aktivist:in der sozialen Revolution nicht von seiner Klasse trennen lassen darf. Wir sind Teil der Klasse und es ist sogar unsere Pflicht, unsere Klassengeschwister mit revolutionären Ideen zu versorgen. Lassen wir uns doch den Vorwurf des Leninismus nicht gefallen, wenn wir dieser Pflicht nachkommen.
Abschließend will ich also festhalten, dass ich das Gefühl habe, dass noch nicht alle Konsequenzen einer spezifisch anarchistischen Organisation voll durchdacht sind und dass deswegen die Projekte noch nicht richtig an Fahrt gewinnen. Der organisierte revolutionäre Marxismus ist dem um Lichtjahre voraus und er kann sich auf jahrzehntelange Traditionen stützen. Es ist daher dringend an der Zeit, dass er durch einen konsequenten Aufbau anarchistischer Kaderorganisationen herausgefordert wird, will der Anarchismus nicht wieder historisch zu spät kommen. Denn wo hätte der Anarchismus in der russischen Revolution schon so stark sein müssen, dass er die Bolschewiki im Oktober 1917 herausfordern hätte können? – Richtig - spätestens im Oktober in der Rätebewegung! Arbeiten wir daran, dass in der Vorbereitungszeit für die kommende sozialen Revolution der Aufbau von spezifisch anarchistischen Organisationen mit mindestens der gleichen Energie vorangetrieben wird, wie es die Marxist:innen tun.
Insofern gilt es eine Praxis zurückzugewinnen, die zu Unrecht nur von den Traditionen des Bolschewismus vereinnahmt wird. Die Vereinnahmung geht so weit, dass sogar ein anarchistischer Vollblutrevolutionär wie Abel Paz den wiederzugewinnenden Kampfgeist nicht anders als folgendermaßen ausdrücken konnte: „Der mit der abweichenden Meinung war natürlich ich. Meine Konzeption der Revolution war bolschewistisch. Ich überlegte und sagte, weil wir den Palacio de la Generalitat nicht angegriffen und mit dem Stalinismus der PSUC nicht aufgeräumt hätten, seien wir die Verlierer. Meine Position deckte sich eher mit der, die „Los Amigos de Durruti“ – sie waren Bolschewisten – vertraten, als mit der klassisch anarchistischen von Kropotkin und Malatesta.“ (Abel Paz. Anarchist mit Don Quichottes Idealen. Innenansichten aus der spanischen Revolution. Eine Biographie 1936-1939. Seite 143).